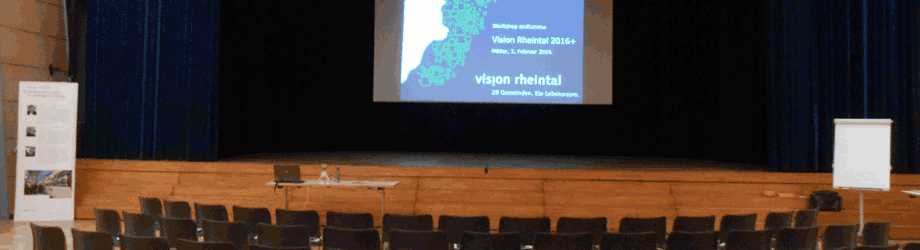Überlegungen zu den Leitgedanken
Leitgedanke 1 - Stärkere Regionalisierung
Die zukünftige raumplanerische Zusammenarbeit erfolgt in kleineren Planungsregionen, den Kooperationsräumen, die das gesamte Rheintal und z.T. angrenzende Gemeinden (z.B. Leiblachtal, Buch als Mitglied der Hofsteigregion) abdecken. Teilweise wird dabei auf bestehenden Regio-Strukturen oder regionalen Beziehungen aufgesetzt (z.B. Regio Vorderland, amKumma, Hofsteigregion). Es besteht allerdings keine Verpflichtung zur Bildung einer formalen Regio. Über verschiedene „Mechanismen“ soll eine Vernetzung und übergeordnete Abstimmung mit den anderen Planungsregionen sichergestellt werden. Vorläufig werden für das Rheintal fünf Planungsregionen vorgeschlagen. Das Modell funktioniert auch mit abweichenden Regionen bzw. kann es auf ganz Vorarlberg ausgeweitet oder übertragen werden.
Leitgedanke 2 - Höhere Verbindlichkeit
Die in den Interviews und in Workshops mit den Gemeinden mehrfach geforderte höhere Verbindlichkeit von Entscheidungen (und deren Umsetzung) soll im neuen Strukturmodell durch mehrere Maßnahmen erreicht werden – in einer Mischung aus positiven Anreizen und aus Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung:
- Die Grundlage der gemeindeübergreifenden (Raum-)Planung und für mehr Verbindlichkeit ist die Erstellung regionaler räumlicher Entwicklungskonzepte (regREK), die in allen Kooperationsräumen des Rheintals erforderlich ist. Dieses ist in jeder Gemeinde per Gemeindevertretungsbeschluss zu bestätigen.
- Das regionale REK soll eine professionelle Planungs- und Verwaltungskultur im urbanen Rheintal sicherstellen und wird daher über gezielte Förderungen des Landes sehr stark unterstützt. Dadurch soll ein großer positiver Anreiz geschaffen werden, dass alle Gemeinden einer Planungsregion bei der Erstellung des regionalen REK mitwirken.
- Dem Land kommt eine stärkere aktive, steuernde Rolle zu. Es unterstützt die Verbindlichkeit der Planungen über die Förderschiene bzw. über aufsichtsbehördliche Genehmigungen.
Leitgedanke 3 - Inhaltliche und operative Flexibilität
Das neue Strukturmodell soll den Gemeinden größtmögliche Flexibilität hinsichtlich ihrer inhaltlichen, strukturellen und operativen Ausrichtung gewähren. Es gilt der Grundsatz, möglichst auf bestehenden Strukturen in der Region aufzusetzen und sich in Kooperationen so zusammenzufinden, wie es thematisch und organisatorisch am zweckmäßigsten ist.
Leitgedanke 4 – Dienstleistungsorientierung
Servicestelle(n) Raumplanung
Für kleine bis mittelgroße Gemeinden sollen bei Bedarf in der Region Servicestellen eingerichtet werden, in denen auf (administrative) Unterstützungsleistung für örtliche und überörtliche Planungsaufgaben zugegriffen werden kann, z.B.
- Personelle Ressourcen – Projektleiter auf Zeit
- Unterstützung in Verfahren: Umwidmungen, Überarbeitung Flächenwidmungsplan, Umlegungen, regREK, Bürgerbeteiligungsverfahren
- Juristische Expertise
- Standardisierung von Dokumenten/Schriftverkehr durch einheitliche Vorlagen
- Befähigung der gemeindeinternen Ausschüsse z.B. Präsentation aufbereiten, Artikel verfassen etc.
- Zentrale Auskunftsstelle (Datenbank, Wissenspool)
- Administrative Unterstützung Abstimmung von Sitzungsterminen, Zeitpläne erstellen und managen ….
Servicestellen sind eine optionale, ergänzende Möglichkeit in der neuen Struktur. Es besteht keine Verpflichtung zur Einrichtung einer Servicestelle. Auch kann eine Servicestelle für mehrere Kooperationsräume zuständig sein (Pooling von Ressourcen aus bestehenden oder neuen Mitarbeitern). Idealerweise dockt sie an bestehende Strukturen in den Regionen an (z.B. Bauverwaltungen).
Leitgedanke 5 - Aktive Rolle des Landes
Dem Land Vorarlberg kommt als aktivem Partner der Gemeinden die Aufgabe zu, in einer Regio-Koordinationsstelle Raumplanung die Kooperationsräume zu koordinieren und die wichtigen Zukunftsthemen – in Abstimmung mit den Regionen – federführend zu bearbeiten. Konkret bedeutet das:
- Einbringen der Position des Landes in die Erstellungsprozesse der regionalen räumlichen Entwicklungskonzepte der Kooperationsräume
- Laufende Koordination und Vernetzung der Koordinationsräume im Rheintal (regREK-Managements) als erster Schritt;
- Zentraler Ansprechpartner für die Kooperationsräume für alle Themen mit gemeindeübergreifendem Raumplanungs-Bezug
- Motor für Zukunftsthemen und die im Prozess definierten drängenden Themen, die „harten Nüsse".